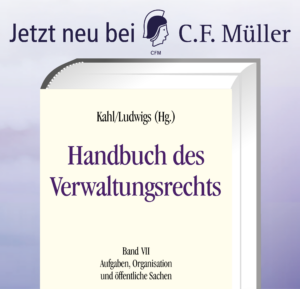Ein „Krieg ohne Grenzen“: Die erneute Blockade des Gazastreifens geht in den zweiten Monat. Zahlreiche internationale Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen warnen davor, dass sich Hunger ausbreitet und lebenswichtige Medikamente fehlen. Mangelernährung, Krankheiten und andere vermeidbare Leiden würden wahrscheinlich zunehmen – insbesondere unter Kindern. Die erneute Verweigerung notwendiger humanitärer Hilfe rückt damit eine besonders verheerende Methode der Kriegsführung zurück in den Fokus: das Aushungern der Zivilbevölkerung.
Wir haben mit Tom Dannenbaum, einem international führenden Experten zu diesem Thema, über die verheerende Wirkung von Hunger als Kriegswaffe und die völkerrechtliche Bewertung der Lage in Gaza gesprochen.
1. Seit dem 2. März 2025 lässt Israel erneut keinerlei Lebensmittel oder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen – die längste vollständige Blockade humanitärer Hilfe seit Beginn des Krieges. Bereits im vergangenen Jahr wurde Gaza mehrfach an den Rand einer Hungersnot gebracht. Jetzt, im zweiten Monat der neuen Blockade, schlagen immer mehr Hilfsorganisationen und UN-Vertreter*innen erneut Alarm. Wie wirkt sich diese Blockade auf die Zivilbevölkerung aus?
Vor dem Waffenstillstand haben die israelischen Militäroperationen nicht nur zu sehr hohen Zahlen von Toten und Verletzten geführt. Daneben ist auch nahezu die gesamte Bevölkerung in Gaza – oft mehrfach – vertrieben und ein erheblicher Teil der landwirtschaftlichen, medizinischen sowie der Wohn- und Wasserinfrastruktur zerstört oder beschädigt worden. Gleichzeitig führten – wie Sie erwähnten – strenge Einschränkungen beim Zugang humanitärer Hilfe wiederholt dazu, dass die Bevölkerung an den Rand einer Hungersnot geriet.
Nach sechs Wochen mit erweitertem humanitärem Zugang während der ersten Phase des Waffenstillstands stoppte Israel diesen Zugang am 2. März abrupt. Seither sind keine kommerziellen oder humanitären Lieferungen mehr eingetroffen. Gleichzeitig nahm Israel wieder intensive Militäroperationen auf, was zu weiteren Todesfällen, Verletzungen und Vertreibungen führt; auch humanitäre und medizinische Einrichtungen werden dadurch zusätzlich lahmgelegt oder beschädigt. All dies ist ein entscheidender Kontext, um die aktuellen Maßnahmen der israelischen Regierung einzuordnen.
Erstens verschlechtert die erneute Verweigerung humanitärer Zugänge die humanitäre Lage rapide. Von der UN betriebene Bäckereien in Gaza mussten den Betrieb einstellen. Bei etwa 60.000 Kinder wird davon ausgegangen, dass sie mangelernährt sind. Schätzungsweise 91 % der Haushalte leiden unter Wassermangel. Wie Tom Fletcher, Leiter des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, Anfang dieser Woche sagte: „Man hindert uns bewusst daran, Leben in Gaza zu retten – und deshalb sterben Zivilisten.“
Zweitens führen die gravierenden Versorgungsmängel dazu, dass die Palästinenser noch vulnerabler in Bezug auf Gewalt und Verbrechen sind. Neben einer erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten oder Komplikationen bei Verletzungen ist die Bevölkerung noch stärker dem Risiko rechtswidriger Vertreibung ausgesetzt. Sowohl US-amerikanisches als auch israelisches Führungspersonal hat zwar von möglichen „freiwilligen“ Umsiedlungen der Palästinenser aus Gaza gesprochen. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof gilt eine solche Deportation oder Umsiedlung jedoch als „erzwungen“ – und damit als Verbrechen –, wenn sie in einem „Zwangskontext“ geschieht. Ein anhaltender, breiter Entzug der Lebensgrundlage stellt einen solchen Kontext dar.
Drittens droht die intensive und anhaltende Notlage das gesellschaftliche Gefüge in Gaza zu zerreißen. Diese Folge war bereits in früheren Phasen der Belagerung zu beobachten und scheint nun zurückzukehren – Berichte über Plünderungen und einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung mehren sich. Hierin zeigt sich nicht nur das Unrecht, Aushungern als Methode zu nutzen; diese Bedingungen herbeizuführen, verletzt auch Israels Verpflichtung, als Besatzungsmacht für öffentliche Ordnung und Sicherheit in Gaza zu sorgen.
Dass wir diese Auswirkungen bereits kurzfristig sehen können, darf zugleich aber nicht den Blick für die langfristigen Folgen verstellen. Was wir gerade sehen, sind nur die ganz unmittelbaren Folgen.
2. Die Blockade humanitärer Hilfen mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung als Mittel der Kriegführung auszuhungern, scheint eine beunruhigende Rückkehr zu erleben. Berichten zufolge hat das syrische Regime solche Methoden gegen seine eigene Zivilbevölkerung eingesetzt, ebenso wie russische Truppen mit der Belagerung von Mariupol in ihrem Krieg gegen die Ukraine. Sie haben Hungerblockaden in einem Aufsatz unlängst als ein Kriegsverbrechen „gesellschaftlicher Folter“ beschrieben. Was macht Hunger als Methode der Kriegsführung besonders gefährlich – oder, moralisch gesprochen: Was macht diese Methode kategorisch falsch?
Ich wollte den Aufsatz aus zwei Gründen schreiben. Erstens wollte ich dem Narrativ entgegentreten, demzufolge der Entzug von Nahrung (deprivation) gegenüber der Zivilbevölkerung (unausgesprochen) leichter zu rechtfertigen sei als ein direkter Angriff auf eben diese Zivilbevölkerung. Zweitens ist es angesichts der expressiven Funktion des Strafrechts wichtig, auch erklären zu können, worin genau das strafrechtliche Unrecht einer verbotenen Handlung besteht. Soweit ich sehe, wurde das Kriegsverbrechen des Aushungerns bislang noch nicht unter diesem Gesichtspunkt erörtert.
Zum ersten Punkt: Es ist klar rechtswidrig und auch strafbar, eine Zivilbevölkerung direkt anzugreifen. Die Behauptung, damit militante Kämpfer innerhalb dieser Bevölkerung ausschalten zu wollen, ist keine (konflikt-)völkerrechtlich gültige Rechtfertigung – selbst dann nicht, wenn sich diese Kämpfer nur schwer von der Bevölkerung unterscheiden lassen. In direktem Widerspruch zu diesem Grundsatz behaupten nun manche, es könne erlaubt sein, einer Zivilbevölkerung lebensnotwendige Güter zu entziehen – sofern dies dem Ziel dient, die darin eingebetteten Kämpfer zur Kapitulation zu zwingen. Diese Logik ist kaum mit der „Grundregel“ des humanitären Völkerrechts vereinbar, die verlangt, dass in allen militärischen Operationen zwischen Zivilisten und Kämpfern unterschieden wird – nicht nur bei Angriffen.
Manche argumentieren, dass die schrittweise Wirkung von Deprivation – anders als ein plötzlicher Angriff –Schadensbegrenzung ermögliche, etwa durch den Abzug der Zivilisten oder durch Kapitulation der belagerten Gegenseite. Das sehe ich anders. Das Unrecht des Aushungerns liegt nicht allein im Ergebnis (das in manchen Fällen vermieden werden kann, in anderen nicht), sondern im gesamten Prozess – einem Prozess, der eher an Folter erinnert als an Tötung. Die Langsamkeit des Sterbens ist kein mildernder, sondern ein konstitutiver Bestandteil dieses Unrechts.
Folter bedeutet typischerweise nicht bloß, dass die Kosten, an einer bestimmten Entscheidung festzuhalten, in die Höhe getrieben werden. Folter verursacht so viel Schmerz und Leid, dass sie das gesamte Erleben der Betroffenen einnimmt – selbst für jene, die eigentlich bereit wären, für ihre Überzeugungen alles zu opfern. Folter ist darauf ausgelegt, den Willen zu brechen. Ebenso erhöht das Aushungern einer Bevölkerung nicht einfach nur die Kosten des Ausharrens auf Seiten der Kämpfer oder der Zivilisten, die sich weigern, ein belagertes Gebiet zu verlassen oder sich gegen ihre politische Führung zu wenden. Vielmehr wird – wie bei der allumfassenden Qual durch Folter – Hunger, Durst und Krankheit zum alles überlagernden Lebensinhalt der belagerten Gemeinschaft. Selbst wenn das Ziel die Kapitulation der Kämpfer ist, wird jegliche „Milderung“ für die Zivilbevölkerung erst erreicht, indem man deren Willen bricht. Währenddessen stellt sich die biologische Notwendigkeit, dem wachsenden Hunger und Durst zu entkommen, gegen grundlegende menschliche Fähigkeiten wie Solidarität, Freundschaft und Liebe. Gemeinschaften zerbrechen daran. Da diejenigen mit den Waffen wohl die Letzten sind, die hungern, trifft dieses individuell wie gesellschaftlich zerstörerische Leid fast zwangsläufig die Zivilbevölkerung zuerst – noch bevor ein relevanter Druck auf Kämpfer entsteht.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Ziel der auf 12 Bde. angelegten Edition ist, den aktuellen Stand des Verwaltungsrechts Deutschlands und der EU umfassend und systematisch darzustellen. Bd. VII ist der wissenschaftlichen Durchdringung der Verwaltungsaufgaben, des Verwaltungsorganisationsrechts und den Themen Begriff, Status und Arten der öffentlichen Sachen gewidmet. Den Grundlagen der Verwaltungsorganisation, mittelbarer und unmittelbarer Staatsverwaltung und ausgewählten Selbstverwaltungstypen sind eigene Abschnitte gewidmet.
Mehr Informationen hier.
++++++++++++++++++++++++++++
3. Lassen Sie uns über das Völkerrecht reden: Das Aushungern der Zivilbevölkerung als Mittel der Kriegführung ist durch das humanitäre Völkerrecht verboten und gilt nach dem internationalen Strafrecht als Kriegsverbrechen. Dennoch stellt Hunger – auch wenn er in bewaffneten Konflikten weitverbreitet auftritt – nicht automatisch eine Verletzung dieser Vorschriften dar. Wo liegt der Unterschied zwischen einer verheerenden, aber rechtmäßigen Hungersituation unter Zivilisten und dem gezielten Einsatz von Hunger als Kriegsmittel? Könnte eine der Rechtfertigungen, die die israelische Regierung im Zusammenhang mit der (erneuten) Belagerung vorgebracht hat, völkerrechtlich Bestand haben?
Es kann Fälle geben, in denen breitgefächerte akute Ernährungsunsicherheit auftritt, ohne dass dies auf eine vorsätzliche Herbeiführung einer solchen Notlage zurückzuführen ist – und obwohl alle Konfliktparteien bereit sind, humanitären Zugang zu gewähren oder zu erleichtern. In Gaza ist das jedoch eindeutig nicht der Fall, da der Zugang zu lebensnotwendigen Gütern gezielt unterbunden wird.
Analysiert man das Verbot des Aushungerns der Zivilbevölkerung nach dem humanitären Völkerrecht sowie nach dem Vorsatzbegriff im Rahmen des Internationalen Strafgerichtshofs, verstehe ich das vorsätzliche Aushungern als Mittel der Kriegführung so, dass es in zwei Formen vorliegen kann:
Erstens: durch den gezielten Entzug von überlebensnotwendigen Gütern, mit dem Ziel, Zivilisten oder der Zivilbevölkerung den Wert dieser Objekte für die Ernährung zu entziehen (einschließlich des Ziels, durch Hunger auch die darin eingebetteten Kämpfer zu treffen). Wichtig ist hier: Diese Form von Vorsatz kann bereits vorliegen, bevor feststeht, dass Zivilisten tatsächlich in eine Hungersnot geraten.
Oder zweitens: durch den gezielten Entzug von überlebensnotwendigen Gütern aus anderen Gründen – in dem Wissen, dass dieser Entzug mit nahezu absoluter Sicherheit dazu führt, dass Zivilisten in eine Hungersnot geraten. Diese Form des Vorsatzes liegt also auch dann vor, wenn nicht direkt beabsichtigt ist, Zivilisten Nahrung zu verweigern.
Israel rechtfertigte die erneute Belagerung hauptsächlich damit, dass die während der Waffenruhe eingeführte Hilfsgütermenge ausreiche, um die Rückkehr zu einer Hungersnot zu verhindern. Wäre dies empirisch zutreffend, fiele Israels Verweigerung von Hilfsgütern dennoch unter die zweite genannte Form des Verbrechens (würde aber die erste Form nicht ausschließen). Nach inzwischen sechs Wochen erneuter Belagerung und angesichts eindringlicher Hilferufe humanitärer Organisationen ist diese empirische Behauptung jedoch zunehmend schwer aufrechtzuerhalten.
Unabhängig davon hat die israelische Führung ganz offen darüber gesprochen, die Belagerung als Druckmittel einzusetzen – etwa indem sie ankündigte, die „Tore zur Hölle“ zu öffnen, um die Zivilbevölkerung Gazas zu zwingen, die Hamas zu stürzen. Auch die Blockade von Hilfslieferungen oder die Unterbindung der Stromzufuhr, die für die Meerwasserentsalzung nötig wäre, wurde explizit vorgenommen, um die Hamas zu Zugeständnissen zu zwingen. Damit einher geht eindeutig der Entzug von überlebensnotwendigen Gütern, um deren Wert für die Ernährung vorzuenthalten – und betrifft somit die erste der beiden oben skizzierten Formen des Kriegsverbrechens. Dies deutet auch darauf hin, dass die Verantwortlichen dieser Politik selbst nicht daran glauben, dass die Vorräte in Gaza ausreichen – denn wenn dem so wäre, gäbe es keinen Druckeffekt.
Ein letztes Argument, das zugunsten Israels vorgebracht wird, stützt sich auf eine Einschränkung der Verpflichtungen aus Artikel 23 der Vierten Genfer Konvention. Demnach dürfe Israel den Zugang zu Hilfen behindern, wenn zu befürchten stehe, dass diese an die Hamas weitergeleitet werden oder ihr anderweitig zugutekommen. Das Argument ist jedoch aus dreierlei Gründen problematisch: Erstens haben humanitäre Organisationen wiederholt erklärt, dass es keine solche großflächige Weiterleitung gebe. Zweitens hat Israel – selbst nach den Bestimmungen der Vierten Genfer Konvention – als Besatzungsmacht keine Entscheidungsfreiheit, humanitäre Hilfe auf dieser Grundlage zu verweigern. Vielmehr hat Israel – wie in den Artikeln 55 und 59 der Vierten Genfer Konvention spezifiziert – eine Primärpflicht, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medizin sicherzustellen und – falls diese Versorgung unzureichend ist – die Sekundärpflicht, Hilfsmaßnahmen vorbehaltlos zuzulassen. Drittens: Selbst wenn man davon ausgeht, dass Israel keine Pflichten nach dem Besatzungsrecht hätte, dürfen nach dem Verbot des Aushungerns von Zivilisten als Kriegsmethode – das Jahrzehnte nach den Genfer Konventionen zu Gewohnheitsrecht wurde –der Zivilbevölkerung lebensnotwendige Güter nicht mit der Begründung entzogen werden, dass einige der Hilfsgüter einer gegnerischen Gruppe zugutekommen könnten. Die Einschränkung in Artikel 23 der Vierten Konvention ist intern zu verstehen; sie kann nicht das erlauben, was andere Regeln des humanitären Völkerrechts ausdrücklich verbieten.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Call for Papers! Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) widmet seine erste interdisziplinäre Jahreskonferenz, organisiert von Nicola Fuchs-Schündeln, Daniel Ziblatt und Michael Zürn, dem Thema „The Future of Democracy?“. Forschende aus den Disziplinen Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie und Recht sind eingeladen, Beiträge einzureichen, die sich mit den Herausforderungen für liberale Demokratien befassen und Lösungen zur Sicherung demokratischer Institutionen untersuchen. Der Einsendeschluss für die Beiträge ist der 30. April 2025, und die Konferenz findet am 9. und 10. Oktober 2025 am WZB statt.
++++++++++++++++++++++++++++
4. Sie haben eben auf den Zwangscharakter dieser Entziehung lebensnotwendiger Güter hingewiesen, also auf die Strategie, Zivilist*innen in Gaza dazu zu bringen, die Hamas zu stürzen. Ich würde gern etwas näher auf das Verhältnis zwischen dieser Zwangsnatur und dem Vorsatz eingehen. Das Verbot der Aushungerung von Zivilist*innen spielt auch eine zentrale Rolle bei den Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanyahu und Gallant. Auch hier ist die entscheidende Frage die nach dem Vorsatz. Artikel 8(2)(b)(xxv) des Römischen Statuts verbietet den vorsätzlichen Einsatz von Aushungerung als Kriegsmethode. Können Sie näher erläutern, inwiefern die Zwangsnatur der Deprivation in Gaza diese Anforderungen erfüllt?
Es gibt keinen internationalen Präzedenzfall für eine Strafverfolgung nach Artikel 8(2)(b)(xxv). In dieser juristischen Leerstelle entfalten sich einige Debatten darüber, wie das subjektive Element („mens rea“) auszulegen ist. Wie eben erläutert, bin ich der Auffassung, dass Vorsatz entweder in direkter Form vorliegen kann (wenn die Versorgung gezielt mit dem Ziel verweigert wird, Zivilisten zu treffen) oder in indirekter Form (wenn der Entzug mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zivilisten in den Hunger treibt).
Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die Zivilbevölkerung ihren Schutzstatus nicht dadurch verliert, dass sich Kämpfer unter ihr befinden. Besteht die betroffene Bevölkerung überwiegend aus Zivilisten, gilt sie insgesamt als Zivilbevölkerung. Ebenso entscheidend ist, nicht Zielrichtung und Endzweck zu verwechseln. Eine Maßnahme kann sich vorsätzlich gegen Zivilisten richten, auch wenn das letztliche Ziel darin besteht, Kämpfer innerhalb dieser Bevölkerung zu schwächen oder zu zwingen. In einem solchen Fall ist es notwendige Voraussetzung, um auf die eingebetteten Kämpfer Druck auszuüben, der Bevölkerung als Ganzes Versorgung zu verweigern.
Während der ersten sechs Wochen des Waffenstillstands bestand ein gewisser humanitärer Zugang – deshalb war durch die Belagerung ab dem 2. März nicht sofort mit Sicherheit massenhafter Hunger zu erwarten. Aber es gibt starke Anhaltspunkte dafür, dass es von Anfang an darum ging, lebensnotwendige Versorgung vorsätzlich zu entziehen.
Die Maßnahmen hatten und haben nach wie vor offensichtlich Zwangscharakter. Als Benjamin Netanyahu die erneute Belagerung ankündigte, stellte er den humanitären Zugang für eine weit überwiegend zivile Bevölkerung als Verhandlungsmasse gegenüber der Hamas dar. Die Ratio hinter dem Entzug humanitärer Hilfe beschrieb er so: „Es wird kein free lunch geben. Wenn die Hamas glaubt, sie könne von den Bedingungen der ersten Phase profitieren, ohne dass wir Geiseln zurückbekommen, irrt sie sich gewaltig.“ Verteidigungsminister Yisrael Katz sprach von den „Toren zur Hölle“, während Energieminister Eli Cohen die Stromabschaltung mit dem Ziel begründete, eine wichtige Entsalzungsanlage lahmzulegen. Der Druckeffekt dieser Maßnahmen beruht darauf, lebensnotwendige Güter wie humanitäre Hilfe und Trinkwasser zu verweigern. Beides sind überlebenswichtige Objekte. Dieser Entzug richtet sich an eine überwiegend zivile Bevölkerung – also an eine klar geschützte Gruppe im Sinne des humanitären Völkerrechts. Kurz gesagt: Die Schwelle zum direkten Vorsatz ist erreicht.
Verschlechtert sich die Lage weiter, steigt auch die Sicherheit, dass fortgesetzte Blockaden zu Hunger führen werden. Doch selbst wenn diese Sicherheit (noch) nicht gegeben wäre, ist sie für die Strafbarkeit nicht erforderlich – denn bereits der bewusste Entzug genügt.
5. Die verheerenden Folgen der erneuten Verweigerung humanitärer Hilfe in Gaza könnten auch im laufenden Genozidverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) relevant werden. Welche Bedeutung hat die Blockade humanitärer Hilfe in diesem Zusammenhang? In welchem Verhältnis steht Hunger als Mittel der Kriegführung zu den erhobenen Vorwürfen?
Die in der Völkermordkonvention definierte Straftat umfasst fünf Handlungsformen. Eine davon ist die Auferlegung von „Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen“. Diese Form überschneidet sich erheblich mit dem Kriegsverbrechen des Aushungerns. Um als Völkermord zu gelten, müssen solche Lebensbedingungen jedoch mit der Absicht herbeigeführt werden, die Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten.
Die weitverbreitete Verweigerung von Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung und anderen überlebenswichtigen Gütern kann zweifellos die Schwelle solcher zerstörerischen Lebensbedingungen überschreiten. In der Pressemitteilung zu den Haftbefehlen gegen Netanyahu und Gallant stellte die Vorverfahrenskammer des IStGH fest, dass es „begründete Verdachtsmomente“ gebe, wonach das Fehlen von Nahrung, Wasser, Strom, Treibstoff und medizinischen Gütern Bedingungen geschaffen habe, „die auf die physische Zerstörung eines Teils der Zivilbevölkerung Gazas abzielen“. Diese Feststellungen betrafen damals die Untersuchung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch dieselben Erwägungen wären auch entscheidend, um zu prüfen, ob damit auch der zugrunde liegende Tatbestand des Völkermords erfüllt ist.
Man kann überzeugend argumentieren, dass die Situation in Gaza die Schwelle solcher zerstörerischen Lebensbedingungen überschritten hat. Ob dies die Entscheidung des IGH beeinflussen wird, hängt jedoch davon ab, ob Südafrika nachweisen kann, dass dies mit genozidaler Absicht geschieht oder geschah.
*
Editor’s Pick
von EVA MARIA BREDLER
Was haben Sie heute Nacht geträumt? Charlotte Beradt, eine Berliner Journalistin, hätte es wohl gerne gewusst. Sie sammelte Träume, die zwischen 1933 und 1939 in Deutschland geträumt wurden. Egal ob jung oder alt, „Schneiderin, Nachbar, Tante, Milchmann, Freund“: Das Geträumte ähnelt sich. Es enthält „Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft“, wie Beradts enge Freundin Hannah Arendt sie erst viel später formulierte. Besonders beeindruckt hat mich die nüchterne Eleganz, mit der Beradt die Schreckensträume in „Das Dritte Reich des Traums“ dokumentiert – und dass sich die Träume aus „der ersten Zeit des noch leisetretenden Regimes“ kaum von denen kurz vor Kriegsbeginn unterscheiden. So erinnert sich ein Träumer schon 1933: „Ich bin aufgewacht mit dem Gefühl, daß unser ganzes Dasein verändert werde. Im bewußten Wachen glaubte ich, daß wir dem Schlimmsten entgehen könnten, aber mein Unterbewußtes wußte es besser.“
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
Sie haben sich geeinigt, Union und SPD: 144 Seiten voller Versprechen, überschrieben mit „Verantwortung für Deutschland“. Große Worte, genretypisch. Schließlich sollen Koalitionsverträge als rechtlich unverbindliche Versprechen nach allen Seiten politisches Vertrauen herstellen. Was ist das eigentlich, Vertrauen? Erst gestern habe ich das eine Freundin gefragt (zufällig angehende Psychotherapeutin): „Es ist wie ein Tanz“, sagte sie, „Am Anfang muss man erstmal den Takt finden, die ersten Schritte machen, stolpert vielleicht. Aber man vertraut auf die Führung. Und je klarer und zuverlässiger die Führung ist, desto mehr vertraut man und kann loslassen.“
Bei abrupter Führung nach der Methode „Brecheisen“ wird man dagegen behutsam. So hat das Landesamt für Einwanderung Berlin drei Unionsbürger*innen des Landes verwiesen, wegen Straftaten, die ihnen im Zusammenhang mit einer Besetzung der Freien Universität vorgeworfen werden. THOMAS OBERHÄUSER (DE) erklärt, warum diese Ausweisung von Unionsbürger*innen rechtswidrig sein dürfte, egal ob die Vorwürfe stimmen, und fühlt sich an den Exekutiv(tanz)stil der Trump-Regierung erinnert.
Diese trampelt nämlich rücksichtlos drauf los mit ihren unzähligen rechtswidrigen executive orders. Nun unterzeichnete Trump eine order, die angeblich die US-amerikanische Wahlverwaltung umstrukturieren soll, faktisch aber gewisse Personengruppen von der Wahl ausschließt, indem sie etwa den Nachweis der Staatsbürgerschaft fordert. JOSHUA SELLERS (EN) nimmt die executive order rechtlich auseinander.
Immerhin hat die Trump-Regierung nun einen Fehltritt eingestanden: Abrego Garcia an ein Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador zu überstellen, das für Menschenrechtsverletzungen bekannt ist, sei ein „Verwaltungsfehler“ gewesen. Doch vor dem Supreme Court hält die Regierung weiterhin daran fest, dass ein Bundesgericht nichts dagegen unternehmen könne. The irony: Dieses Argument setze voraus, dass der Präsident – der sich so gern als Dealmaker inszeniert – letztlich ein lausiger Verhandlungsführer sei, erklärt MICHAEL C. DORF (EN).
Dass die Exekutive taktvoll handelte, hat nun das Landesverfassungsgericht Rheinland-Pfalz bestätigt: Zum Schutz der Verfassung dürften sich Ministerpräsidentin und Landesregierung bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit auch gegen verfassungsfeindliche Parteien positionieren. Diese Neubestimmung und Eingrenzung des Neutralitätsgebots sei folgerichtig und könne in der Auseinandersetzung mit der AfD wichtig werden, resümiert ANTJE VON UNGERN-STERNBERG (DE).
Manchmal fehlt der Exekutive allerdings jedes Taktgefühl – und die taktgebende Judikative stößt auf taube Ohren. Das durften wir zuletzt bei Marine Le Pen beobachten, die seit ihrer Verurteilung – inklusive sofortigem Entzug des passiven Wahlrechts – „das System“ beschimpft. Ein politischer Tod von Händen übergriffiger Richter*innen, das Ende der Demokratie? In ihrem übersetzten und aktualisierten Beitrag räumt CHARLOTTE SCHMITT-LEONARDY (EN) mit dem „Skandal“ auf, zeichnet die Ereignisse der vergangenen Woche nach und skizziert, wie es jetzt mit Marine weitergehen könnte.
CAMILLE AYNÈS und ELEONORA BOTTINI (EN) erkennen in dem Pariser Urteil bemerkenswerte richterliche Kreativität ganz im Sinne wehrhafter Demokratie – zeigen sich jedoch besorgt angesichts der Heftigkeit, mit der die Justiz kritisiert wird.
Ähnlich wie Marine Le Pen erging es dem Präsidenten der Republik Srpska, Milorad Dodik. Dieser wurde vom Staatsgericht von Bosnien und Herzegowina zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und für sechs Jahre von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Dabei geht es nicht nur um das Verhältnis von Exekutive und Judikative, sondern vor allem um die Machtverteilung zwischen Bosnien und Herzegowina und der Republik Srpska: Wer führt, wer folgt? Dodik wird vorgeworfen, das Dayton-Friedensabkommen verletzt zu haben. Daraufhin legte Dodik eine neue Verfassung vor, mit der er die Autorität des Gerichts offen infrage stellt. MILOŠ DAVIDOVIĆ und MAJA SAHADŽIĆ (EN) analysieren den komplexen institutionellen und prozeduralen Tanz um die Macht.
RENA HÄNEL (EN) erklärt, wie Dodik die neue Verfassung nutzt, um sich nicht nur seiner Strafbarkeit zu entziehen, sondern die Verfassungsordnung und -institutionen von Bosnien und Herzegowina anzugreifen.
Unterdessen greift Ungarns Premier Viktor Orbán eine andere Institution an: den Internationalen Strafgerichtshof. Orbán lud Netanjahu – trotz Haftbefehls des IStGH – zum Staatsbesuch und kündigte zugleich den Austritt aus dem Gericht an, das er als „politisch voreingenommen“ diskreditierte. Damit schade Orbán der Glaubwürdigkeit der EU, meint PETER VAN ELSUWEGE (EN) und schlägt vor, wie die EU jetzt reagieren sollte.
Dass die EU ein „Orbán-Problem“ hat, ist nichts Neues. Orbán blockiert, wo er kann – innen illiberal, außen prorussisch: Budapest blockiert mit seinem Vetorecht regelmäßig Militärhilfen für die Ukraine und verwässert Sanktionen gegen Moskau. Die Kommission solle ein neues Verfahren nach Art. 7(2) EUV anstoßen – mit Fokus auf Verstöße gegen die Solidarität und Gefährdungen der Sicherheit der Union, findet LUKE DIMITRIOS SPIEKER (EN).
Apropos Sanktionen: Im Februar 2022 fror eine Koalition von Staaten, darunter alle G7-Volkswirtschaften, rund 300 Milliarden US-Dollar an russischem Staatsvermögen ein. Mit dem möglichen Ende der EU-Sanktionen wird diskutiert, ob Russlands Zentralbankvermögen in einen Sonderfonds überführt werden sollte – um das Geld für Reparationen verwenden und vor Moskaus Zugriff schützen zu können. ANTON MOISEIENKO (EN) bewertet die Idee nach dem Recht der Staatenverantwortung, das es Staaten erlaubt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die unter normalen Umständen völkerrechtswidrig wären.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Out Now!
Eyes Everywhere: Surveillance and Data Retention under the EU Charter
(edited by Erik Tuchtfeld, Isabella Risini, and Jakob Gašperin Wischhoff)
In “La Quadrature Du Net II”, the CJEU significantly lowered standards for mass data retention under the EU Charter, prioritizing security over privacy. This edited volume explores how this shift may affect EU citizens’ protection of fundamental rights and substantially redefine the surveillance and data retention framework for public and private agents.
Now available as soft copy (open access) and in print!
++++++++++++++++++++++++++++
Kreative Kassenführung gibt es auch in Berlin und Karlsruhe, von Sondervermögen bis Sonderzuschlag: Das BVerfG hielt nun den Solidaritätszuschlag für verfassungsgemäß und sich für finanzverfassungsrechtlich kontrollbefugt, Richterin Wallrabenstein ist im Sondervotum skeptisch. Für SEBASTIAN HUHNHOLZ (DE) verdeutlichen Entscheidung und Sondervotum ein grundlegendes Dilemma der deutschen Finanzverfassungspolitik: Ihr überkonstitutionalisierter Charakter mache sie störrisch gegenüber den globalen Umbrüchen, verführe genau deshalb aber diverse Beteiligte zu verfassungsrechtlich innovativen Instrumentalisierungen.
Innovativ instrumentalisieren lässt sich auch KI, zum Beispiel in „Deepfakes“. Weil diese jedoch auch allerlei Risiken bergen, fordert eine Künstlergruppe ihr generelles Verbot. JANNIS LENNARTZ (DE) zeigt, dass die Angst vor Deepfakes Teil einer langen Tradition technologiekritischer Künstler ist und dass ein pauschales Verbot die Kunstfreiheit verkennen würde.
Auch das Unionsrecht will KI bändigen. Ab dem 2. August 2025 gelten für Anbieter sogenannter „General Purpose AI“-Modelle weitreichende Pflichten nach dem AI-Act. Zur Nachweisführung können sich die Anbieter auf einen „Code of Practice“ stützen, der derzeit unter der Leitung des AI Office von über 1000 Akteuren erarbeitet wird. MARTIN EBERS (EN) untersucht, wie der Code of Practice den AI Act zu untergraben und demokratische Verfahren zu umgehen droht.
Demokratische Verfahren werden auch in der Entwicklungspolitik gerne umgangen, vor allem durch fehlende Transparenz. Was das Informationsfreiheitsgesetz – und dessen im Koalitionsvertrag angekündigte Reform – damit zu tun haben, erklärt SOFIE-MARIE TERREY (DE).
Doch nur weil etwas nicht öffentlich sind, heißt das nicht, dass es keine Konsequenzen hat: Das haben die vielen rassistischen Äußerungen in polizeilichen Chatgruppen kürzlich immer wieder getestet. Die neue Arbeitsdefinition von Rassimus des Expert:innenrat Antirassismus wurde zwar für die Verwaltung entwickelt, könnte jedoch auch für die dienst- und insbesondere disziplinarrechtliche Einordnung von solchem „vertraulichen Rassismus“ relevant werden, zeigt ANDREAS NITSCHKE (DE).
Mit vertraulichen Räumen hatte auch der Hessische Staatsgerichtshof zu tun, allerdings in der analogen Welt: In seinem Urteil vom 6. März erklärte er die Vorschriften des Hessischen Versammlungsfreiheitsgesetzes und des Gesetzes über die Bannmeile des Hessischen Landtages für ganz überwiegend verfassungsgemäß. Die Entscheidung werde dem strengen Maßstab der Hessischen Verfassung nicht gerecht, kritisiert BEREND KOLL (DE).
Schließlich haben wir unser Symposium zu „Intellectual Property and the Human Right to a Healthy Environment“ (EN) fortgesetzt. JASPER KROMMENDIJK analysiert das Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt aus Perspektive des Unionsrechts, insbesondere seit sich beim EuGH eine ähnliche menschenrechtliche Wendung beobachten lässt. LUISA NETTO beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Anerkennung dieses Menschenrechts und dem – eher vagen und inkonsistenten – Verweis auf künftige Generationen in diesem Kontext. NATALIA KOBYLARZ erklärt, warum die Anerkennung des Rechts auf eine gesunde Umwelt den menschenrechtlichen Umweltschutzrahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention stärken könnte und OTTO SPIJKERS untersucht den völkergewohnheitsrechtlichen Status des Rechts.
Vertrauen ist also ein Tanz zwischen Führung und Hingabe, Vorsicht und Mut, Verantwortung und Freiheit. Wie viel Freiheit uns angesichts der versprochenen Verantwortung der neuen Koalition bleibt? Wir werden sehen.
Zumindest diesen Freitag dürfen wir noch tanzen, nächste Woche bringt der Karfreitag das Tanzverbot. Und auch wir werden am Freitag die Füße stillhalten – der nächste Newsletter ist am 25. April in Ihrem Postfach. Erholen Sie sich gut und tanzen Sie an den anderen Tagen.
*
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als Email zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.